
|

|
TEIL III: Die Siebziger und Achtziger Jahre
Herrmann Kant: Das Impressum, Berlin 1972
In seinem zweiten Roman erzählt Kant die Geschichte von David Groth, der es in der Hauptstadt der DDR vom Boten einer großen Berliner Illustrierten bis zum Chefredakteur gebracht hat. Mit der am Romananfang stehenden Mitteilung konfrontiert, daß er Minister werden soll, reagiert Groth zunächst abweisend. Jedoch prüft er sich, indem er sein bisheriges Leben Revue passieren läßt. Wir erfahren von einer typischen proletarischen Aufsteigerentwicklung, die sich parallel zur DDR-Entwicklung ereignete. In der bekannten schwadronierenden und ironisch stilistischen Eigenart des Autors wird ein Panorama erinnerter Begebenheiten und reflektierter Erfahrungen entfaltet, bei dem Wesentliches neben Belanglosem steht. Je mehr wir von Groth als "Zeitungsmann und Parteimitglied seit zwanzig Jahren" kennen lernen, von seiner Arbeitsbesessenheit, seinem sozialistischem Engagement und seiner Identifikation mit der DDR, umso mehr ahnen wir bei fortschreitendem Verlauf, daß am Ende der fast 500 Seiten doch das Resultat stehen wird, daß er Minister werden möchte. "Ich jedenfalls, holte ihn, und ich jedenfalls - das bleibt wohl noch zu sagen - , ich käme." Die Selbstgefälligkeit des Helden, seine Verliebtheit in die vielen Schnurren und seine Unfähigkeit zu kritischer Selbstanalyse, war seinerzeit bereits von der DDR-Literaturkritik "mit Unbehagen" (Karin Hirdina, 1972) angemerkt worden. Groths Perspektive ist die der Herrschenden, er gehört mit seiner Funktion als Chefredakteur und Verlagsleiter zur machtausübenden Partei-Elite. Dieser Blick prägt auch Groths Schilderung der Ereignisse des 17. Juni, denen er ein Dutzend Seiten widmet. Er bewahrt aus jenen Tagen ein von ihm geheim gehaltenes Foto auf, auf dem der ihm bekannte Minister Fritz Andermann (Selbmann) versucht, zur protestierenden Menge zu sprechen. "Es war ein Mann darauf zu sehen, bedrängt von anderen Männern, gegen einen Pfeiler gedrückt im Regen, ein Mann, der was war: entsetzt, erschrocken, wütend, verzweifelt, erstaunt, ungläubig, voll Haß und am Ende?" Groth versetzt sich in dessen Gedanken: "Er ist ein Träumer gewesen; er hat die hinter sich geglaubt, um sich, die jetzt vor ihm stehen, gegen ihn drängen und ihm aus Leben wollen; vielleicht weniger wollen als sollen, aber das macht im Augenblick keinen Unterschied (...) nach acht Jahren, von denen er gemeint hatte, weil sie so anders waren als alle davor, müßten in ihnen auch die Menschen ganz anders geworden sein, als sie es vorher gewesen waren." Aus der Perspektive der Macht kommen hier weder die ökonomischen Ursachen der Arbeiterproteste noch die politischen Fehler der Parteiführung in den Horizont, hier dominiert allein das Trauma eines möglichen Machtverlustes. Angesichts seiner aktuellen Möglichkeit, eventuell auch ein Minister zu werden, endet Groths rückblickende Überlegung in dem sehr entschiedenen Wunsch, dass er niemals in einer historisch brisanten Lage so aussehen möge.
Dieser Tag als "grimmigster aller Schrecknisse" sollte jedoch eine Langzeitwirkung entfalten: "die Hoffnung sollte es lange schwer haben, die Enttäuschung machte auf Jahre die Augen schmal, machte die Sinne überscharf, machte die Fäuste hart, schmälerte das Vertrauen (...) der Kampf ist noch nicht zu Ende, wir sind noch nicht soweit." Seine Haltung aus diesem historischem Lehrstück fasst Groth zusammen: "dem Feind keinen Fußbreit Boden und jenem Junitag nie wieder eine Chance."
Angesichts dieser klaren parteilichen Aussage erstaunt die Zensurgeschichte dieses Buches, das nach einem 1969 abgebrochenen Vorabdruck (im "Forum") drei Jahre, zwar ausgedruckt, aber nicht gebunden, liegen blieb. In der Zensur-Behörde des Ministeriums für Kultur (der "Hauptverwaltung Buchhandel und Verlage") fand man das Buch "erstens philosemitisch, zweitens antisemitisch und drittens pornographisch", wozu man aufgrund von Mißinterpretation einiger der zahlreichen Schnurren gekommen war. Die Haltung, daß einer nicht Minister werden wolle, erregte die Staatsfunktionäre im Kulturministerium. 1972 gab Kant auf einer Veranstaltung des Schriftstellerverbandes der DDR in der Diskussion über Tabus an, daß er mit seinem Romananfang ein "ideologisches Tabu" aufgegriffen habe. Vor dem VIII. Parteitag sei es so gewesen, daß "ein jeder zum Beispiel studieren mußte, wenn es nur irgendwie ging, daß ein jeder höchste Funktionen einnehmen konnte und mußte, wenn er für solche für würdig befunden wurde durch die Partei oder andere gesellschaftliche Organe."
Danach hätten sich "neue Erkenntnisse in der Arbeit mit den Menschen" durchgesetzt.
Zum eigentlichen Hintergrund erfahren wir aus seinem autobiographischen "Abspann" (Erinnerung an meine Gegenwart, Berlin und Weimar 1991) einiges mehr. So hatte er durch ein vorlautes Interview im westdeutschen "Vorwärts", indem er gemeint hatte, dem Politbüro deutschlandpolitische Ratschläge erteilen zu können, das Politbüro mit Ulbricht persönlich an der Spitze verärgert. Was wir hier nicht erfahren war, dass sich in dieser Lage auch die Stasi, für die er eifrig als Berichteschreiber tätig war (als Inoffizieller Mitarbeiter "Martin"), außerstande sah, etwas für ihn zu tun. Zumal es für sie natürlich auch an dem "für die DDR nicht typischen, unrichtigen und schädlichen Inhalt" nichts zu zweifeln gab. Nur durch inhaltliche Veränderungen, meinte die Stasi, könne noch "ein brauchbares literarisches Werk" entstehen (vgl. hierzu: Karl Corino: Die Akte Kant. IM "Martin", die Stasi und die Literatur in Ost und West, Reinbek bei Hamburg 1995).
Nachdem sich Kant 1972 zu einer Reihe von Änderungen bereit erklärt hatte, kam das Buch nun fast gleichzeitig in beiden deutschen Staaten heraus.
|

|
> Einleitung
> 50iger Jahre
> 60iger Jahre
> 70/80iger Jahre

|
Erik Neutsch: Auf der Suche nach Gatt, Halle 1973
Die Lebensgeschichte Eberhard Gatts, des Mansfeldkumpel und Parteijournalisten, erhält ihre Brisanz aus der Tatsache, daß von einem Scheitern, beruflich sowohl wie privat, berichtet wird. Die Erzählung beginnt vom Ende her, als sich ein junger Journalist, der von dem legendären und verschollenen Gatt gehört hat, auf die "Suche" nach ihm begibt, weil ihn dessen konflikthafter Lebensweg interessiert. Aus verschiedenen Erzählperspektiven ergibt sich nach und nach ein komplexes Bild von einem starken, aber eigenwilligen Charakter, dessen beruflicher Aufstieg hart erkämpft erscheint und dessen rigides sozialistisches Engagement ihn wiederholt in Konflikte mit seiner eigenen Partei bringt. Seine leidenschaftliche Wahrheitssuche kollidiert zuweilen mit dem verbreiteten Erfolgsjournalismus der DDR-Presse. Seine Frau, aus intellektuellen Verhältnissen stammend, für die Gatt symbolisch und konkret "die Arbeiterklasse" verkörpert, gerät durch die Republikflucht ihres Chefs in den Verdacht der Mitwisserschaft und kommt vor Gericht. Obgleich von ihrer Unschuld überzeugt, läßt sich Gatt vor allem durch den Rat seines Chefs und erfahrenen Genossen, Emigranten und Widerstandskämpfers, und von dem durch die Stasi geschürten Mißtrauen gegenüber seiner Frau so weit beeinflussen, daß er sie zeitweilig ernsthaft verdächtigt. Nachdem Ruths Unschuld erwiesen ist, trennt sie sich von ihrem Mann, nachdem sie tiefenttäuscht ihr gemeinsames Kind hat abtreiben lassen.
Mit diesem privatem Versagen beginnt auch Gatts beruflicher Abstieg, als "Mann der ersten Stunde" verweigert er sich zunehmend den neuen politischen und wissenschaftlichen Herausforderungen, lehnt eine notwendige Qualifizierung ab, verrennt sich gegenüber jüngeren Genossen. Nach Entlassung aus der Redaktion übt er eine ungeliebte Tätigkeit im Handel aus. Sein Ziel jedoch ist es, seine geschiedene Frau wiederzufinden, was ihm letztlich auch gelingt. Sie ist inzwischen Ärztin geworden, verheiratet mit zwei Kindern. Auch sie scheint mit Gatt noch nicht ganz fertig zu sein, denn nach ihrer Wiederbegegnung bleibt die weitere Entwicklung ihrer Beziehung offen.
Die Ereignisse des 17. Juni spielen in Gatts Leben eine besondere Rolle, da er dabei fast ums Leben gekommen wäre. Sie erscheinen im Roman ausschließlich als "Konterrevolution" und als "faschistischer Putsch", an dessen Zustandekommen vor allem alte und neue Faschisten und andere "Feinde der Republik" beteiligt sind. In einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter gerät er in tätliche Auseinandersetzungen mit randalierenden "Burschen mit kurzgeschorenen Haaren, zitronengelben Hemden und Ringelsocken an den Füßen". Das Haus der FDJ-Leitung war in Brand gesteckt worden, auf einem Scheiterhaufen loderten Aktenmappen und Bücher. Bei dem Versuch, einen Lastwagen zu stoppen, der im Schlepptau die blutig zugerichtete Leiche eines Polizeiwächters hinter sich her schleift, wird Gatt durch fünf Pistolenschüsse lebensgefährlich verletzt. Bei den Fahrern des Wagens habe es sich um ehemalige KZ-Aufseher gehandelt, die aus dem Gefängnis ausgebrochen, jedoch schnell gefaßt und abgeurteilt wurden.
Neutsch setzt bei diesem Handlungskomplex einen aufschlußreichen Akzent: Gatt verstößt deutlich gegen die Parteiorder, nach der sich die Journalisten nicht auf die Straße begeben, sondern die "Machtstellung" halten sollten. Wegen seiner schweren Verletzung kommt die Parteigruppe darauf später nicht mehr zurück, und er wird als Held gefeiert. Gatt sieht seinen Chef als jemanden an, der sich unter dem Schreibtisch verkrochen habe, statt dem Feind entgegenzutreten. Noch Jahre später wird sein Gefühl beherrscht von dem Empfinden: "Die Faschisten auf der Straße, wir aber ohne Waffen". Auch in einem anderen Punkt bleibt die Kritik an dem alten Genossen, seinem Chef, ambivalent. Als es um die Distanzierung Gatts von seiner Frau geht, argumentiert dieser auf typisch stalinistische Manier: "Lieber einen Menschen opfern als die Menschheit, Sauberkeit, Sicherheit in jeder Beziehung."
Die Krisenhaftigkeit dieser Gatt-Geschichte und ihre Ambivalenzen bescherten dem parteibewußten Autor eine längere Diskussion mit den literarisch zuständigen "Behörden" . Erst nach sechs Jahren und mehreren Überarbeitungsstufen hinsichtlich des "ideologischen Reifestandes" kam das Buch dann 1973, ein Jahr darauf auch in der BRD heraus. Ein nach dem Roman 1975 gedrehter zweiteiliger Fernsehfilm, der auch die brutalen Szenen um den 17. Juni enthält, wurde auch von einem westdeutschen Sender gezeigt. Die Wertung des 17. Juni im o.g. Sinne behält Neutsch auch in dem Zweiten Buch seines Mehrbänders "Der Friede im Osten" (Frühling mit Gewalt, Halle 1974) bei. Sie wird noch um den Akzent Antisemitismus verstärkt, wenn er hier den Parteisekretär, der Jude ist, in Panik in den Westen fliehen läßt.
Stefan Heym: 5 Tage im Juni, München 1974/Berlin 1989
Mit diesem Roman haben wir den zentralen literarischen Text über die Juni-Ereignisse 1953 vor uns und wohl einen der umstrittensten in der deutschen Nachkriegsliteratur überhaupt. Zugleich handelt es sich um das bekannteste Unbuch der bekanntesten Unperson der DDR. (Herbert Krämer, 1999) Unmittelbar unter dem Eindruck der Juni-Geschehnisse begonnen, durchlief das Manuskript mehrere Fassungen, erfuhr wichtige konzeptionelle Veränderungen, bis es 1974 im westdeutschen Bertelsmann Verlag erschien. Eine DDR-Ausgabe kam trotz wiederholter Anläufe fast symbolisch erst zum Ende des Staates heraus, der es als "staatsgefährdend", "parteischädlich", "antinational" ansah und der diese "völlig falsche Darstellung der Ereignisses des 17. Juni" über mehrere Jahrzehnte nicht hatte drucken wollen.
Heym erzählt die Ereignisse von 5 Tagen, wie sie sich vor allem in einem Berliner Großbetrieb der Metallindustrie ("VEB Merkur") abspielen. Mit dem Ziel einer "gewissen Authentizität" (Stefan Heym 1975) montiert der Autor in den chronikartigen Ablauf zahlreiche historische Texte (Zeitungsmeldungen, Verlautbarungen der SED, Erklärungen des RIAS u.ä.), die den fiktionalen Text stützen oder kontrastieren sowie historisch fundieren sollen. Die Handlung setzt ein am 13. Juni, als sich der Gewerkschaftsvorsitzende Martin Witte gegen die angeordneten Normerhöhungen stellt. Der klassenkampferfahrene Parteiarbeiter Witte ist die Hauptfigur des Buches, das zu großen Teilen auch aus seiner Perspektive erzählt ist. Er verkörpert den Typ des selbstlosen, aufrechten Funktionärs, der an der Basis den eskalierenden Arbeiterunmut spürt und für Methoden der Überzeugung statt der Administrierung eintritt. Wegen seiner unüblichen Arbeitsweise und seines Aufbegehrens gegen eine dogmatische Parteipolitik gerät er in einen Dauerkonflikt mit den anderen Funktionären im Betrieb und dem übergeordneten Parteisekretär. Als es zur Arbeitsniederlegung und Beteiligung der Werksarbeiter an den städtischen Streik-Demonstrationen kommt, gelingt es Witte durch entschlossenes Handeln, einen Teil der Belegschaft wieder ins Werk zu holen. Die Ereignisse des 17. Juni erscheinen bei Heym in erster Linie als hausgemacht, als handfeste politische und ökonomische Krise, als arbeiterliche Protestaktionen gegenüber einer oktroyierten Politik, die sich über die aktuellen Arbeits- und Lebensinteressen der werktätigen Bevölkerung hinwegsetzt. Erst in zweiter Linie kommen auch bei ihm die Einflüsse des Westens ins Bild: der Arbeiter Gadebusch hat Verbindungen zum Ost-Büro der SPD und verwickelt auch den Streikführer Kallmann darin. Und es gibt auch den agent provocateur, von westlichen Geheimdiensten gesteuert und bezahlt. In der Zeichnung des westlichen Einflusses wirken sich kolportagehafte Elemente (die auch in der Zeichnung verschiedener Partnerbeziehungen nicht zu übersehen sind) im Roman am stärksten aus. So in der Schilderung aller in West-Berlin spielenden Szenen, oder in der Charakterisierung mancher Figuren. Zum Beispiel, wenn ausgerechnet die junge Frau Gudrun, nur "Goddie" genannt, "Berlins begnadetste Stripperin", die Witte vor einem Anschlag warnen will, in den zugespitzten Auseinandersetzungen Unter den Linden Opfer des verirrten Geschosses eines sowjetischen Panzers wird.
In der Darstellung der Betriebsbelegschaft jedoch gelingt Heym ein differenziertes Bild. Insbesondere mit dem Typus Kallmann, dem kleinen "ehrlichen Arbeiter", der den deutschen Facharbeiter, dem es in allen gesellschaftlichen Systemen vor allem um Qualitätsarbeit und ums Geld geht, verkörpert und der von gewichtigen inneren Widersprüchen und der ihm historisch plötzlich zugewachsenen Rolle überwältigt wird. Aus Furcht vor den Folgen seines Tuns verläßt er die DDR, seine Werkbank bleibt leer. Dies ist Teil der Niederlage, die Witte empfindet. Aber er sieht auch einen Sieg, einen Teil des Sieges für die Arbeiterregierung und die Partei, von der es "trotz ihrer Mängel und Fehler" nur die eine gäbe. Es sei eine Verpflichtung für "Genossen mit Herz", angesichts der "Feiglinge, Dummköpfe, Schönfärber und Beamtenseelen, an denen es bei uns in der Partei nicht mangelt", aus "dieser Partei ihre Partei" zu machen. Und Witte resümiert und mit ihm der Autor: "Das Schlimmste wäre, für das eigne Versagen den Feind verantwortlich machen zu wollen."
Genau das aber passierte in der DDR-Geschichtsschreibung, was Heym dazu veranlaßte, immer wieder um die Veröffentlichung seines Buches in der DDR zu kämpfen. Bis zum Schluß hoffte er auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz und begrüßte den demokratischen Aufbruch am Ende der DDR.
|

|
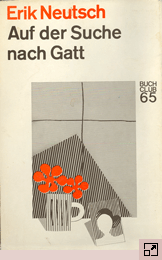
|
Carl-Jakob Danziger: "Die Partei hat immer recht". Autobiographischer Roman, Stuttgart 1976
Hinter dem Pseudonym Danziger verbirgt sich der antifaschistische Journalist und Schriftsteller Joachim Chajm Schwarz, der aus israelischem Exil 1950 in die DDR gekommen war. Als "parteiloser Sozialist" verschrieb er sich Anfang der 50er Jahre leidenschaftlich einer reportagehaften Betriebsliteratur, lange bevor der Bitterfelder Weg erfunden wurde. In mehreren Reportage-Romanen, die jeweils auf langen Recherchen vor Ort basierten, zeichnete er die sozialen Konflikte und Bewußtseinslagen der Arbeiter allerdings so realitätsnah, wie es literaturpolitisch nicht vorgesehen war. Er ging von einer "Misere des deutschen Arbeiters" aus, die sich in mangelhaftem Klassenbewußtsein und kleinbürgerlicher Geprägtheit zeige und nur zu überwinden sei durch angestrengte massenpolitische Bildung und Erziehung. Bei dieser notwendigen aufklärerischen Tätigkeit von Partei und Massenorganisationen erweise sich die verbreitete Schönfärberei und die Phrasendrescherei, auch in der Presse, mehr als schädlich. Hierfür sah er einen Teil des Parteiapparates als verantwortlich an, kritisierte Sektierertum und Karrierismus von Partei- und Staatsfunktionären. Sein Bergmann-Borsig-Buch enthielt anfangs bemerkenswerte Einblicke in die Produktionsprobleme und in die politische und soziale Mentalität der verschiedenen Betriebsangehörigen, gab wieder, was die Arbeiter "wirklich" dachten und auch sagten, prangerte uneffektive Arbeitsmethoden und unfähige Leiter gleichermaßen an. Während die Dargestellten sich mit diesem Text solidarisierten, führten die jahrelangen Veränderungen, die der Autor nach den Maßgaben verschiedener Verlags- und Zensurinstanzen vornahm, 1955 zu einem Ergebnis, das mit dem beabsichtigten kritischen Betriebs-Roman kaum noch etwas zu tun hatte. Schwarz durchlief im Kampf mit den "Instanzen" - der SED, dem DSV, den verschiedenen Verlagen - einen Desillusionierungs- und persönlichen Enttäuschungsprozeß, der ihn zunehmend an seinen sozialistischen Überzeugungen zweifeln ließ. Nachdem er sich 1962/1963 in der Literaturkritik als Paradefall für Schematismus und Naturalismus in der DDR-Literatur vorgeführt sah, erkrankte er und verstummte. Die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 veranlaßten ihn jedoch, zunächst für die Schublade, zum Aufschreiben seiner Erinnerungen. Sie sind lesenswert als Dokument einer gescheiterten Integration eines deutschen Juden in die DDR-Gesellschaft, sie beeindrucken durch die entwaffnende Offenheit, mit der vom Autor seine Auftragsschreiberei ebenso beschrieben wird wie die zum Teil peinlich anmutenden Amouren.
Den Juni 1953 erlebt Schwarz in Berlin und berichtet auch darüber in der "Täglichen Rundschau". In seinen Erinnerungen benennt er neben den unpopulären Maßnahmen die "Schönfärberei in Literatur und Kunst" für den 17. Juni als verantwortlich. Er sieht die Bauarbeiter, "in langen Zügen, sie haben ihre Arbeitskleidung an, man sieht, daß sie gerade vom Bau kommen." Er bemerkt aber auch die "blitzblanken, mit verchromten technischen Spielereien ausgerüsteten Fahrräder, die aus Westberlin stammen. Die sonst so geschickt für Tarnung sorgenden Bosse gewisser West-Organisatoren, die als Arbeitertrupps verkleidete Gruppen geschulter antikommunistischer Propagandaredner herüberschickten, hatten hier einen Fehler gemacht: Sie hätten ihre Burschen auf alte, verbrauchte, rostige Fahrzeuge setzen müssen, um die Herkunft ihrer Sendboten weniger auffällig zu machen." Sein Versuch, sich agitatorisch gegen die West-Provokateure einzumischen, bringt ihn in Gefahr. Seine Stellungnahme für die SED, für die DDR ist in dieser "Stunde der Gefahr" eindeutig: "Sie war meine Heimat, selbst wenn sie mich ablehnte und aus ihren Reihen ausstieß, sie war Sammelplatz der Menschen, die ich verstand und mit denen ich reden konnte, sie war Treffpunkt 'meiner Menschen'. In diesem Augenblick, in dem der deutsche Faschismus aus dem Grabe zu steigen schien, war sie 'meine' Partei". Denn: "Eine deutsche Konterrevolution konnte nur eines ans Tageslicht bringen: den versteckten, lauernden, mühsam getarnten Faschismus mit alle seinen Begleiterscheinungen." In einem Brief an den Schriftstellerverband hatte er am 24.6.1953 u.a. ausgeführt: "Die Scham über die Berliner Arbeiter, die einige unserer Kollegen jetzt empfinden, konnte man bei genauer Beobachtung schon eine ganze Weile vorher empfinden. Die unrealistische, süßlich apologetische Richtung unserer Presse und unserer Gegenwartsliteratur ist mit dafür verantwortlich zu machen, daß gewisse Partei-Instanzen über den Zustand der Massen falsch informiert wurden und daher nicht imstande waren, rechtzeitig ihre Agitationsarbeit auf die erforderliche Höhe zu bringen."
|

|
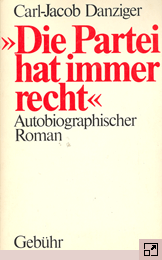
|
Werner Heiduczek: Tod am Meer, Halle 1977
Dieser Roman verdankte seine Popularität in der DDR weniger seinen literarischen Qualitäten, als seiner Zensur-Geschichte. Sprach es sich doch schnell herum, daß auf oberste Weisung des sowjetischen Botschafters in der DDR die zweite Auflage von 1978 verboten werden sollte. Und so war das Buch, noch ehe es dazu kam, bereits aus den Buchhandlungen verschwunden und die Leser gaben es sich von Hand zu Hand. Eine gezielte Denunziation aus dem Parteiapparat war dem Botschafter Abrassimow zugegangen, die er an das Politbüro weiterleitete. Dieses "eindeutig negative Buch" verzerre die Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR in einer abwertenden, zynischen Art und Weise, verunglimpfe die Sowjetarmee und ihre historischen Verdienste. Es beschreibe Vergewaltigungen deutscher Frauen und andere Übergriffe auf die deutsche Bevölkerung durch sowjetische Soldaten, es sei voll von geringschätzigen Bemerkungen über die deutsch-sowjetische Freundschaft, von verächtlichen Charakteristiken von SED-Funktionären und sowjetischen Besatzungsoffizieren usw. usw.
Das solcherart geschmähte Buch enthält aus der Ich-Perspektive erzählt, den autobiographischen Rückblick des Schriftstellers Jablonski, der als knapp über Fünfzigjähriger todkrank in einem bulgarischen Krankenhaus sein Leben bilanziert. Angesichts des nahen Todes fällt dies einigermaßen schonungslos aus. Wir werden bekannt gemacht mit einem widerspruchsvollen Charakter, der mit bleibenden moralischen Schäden aus dem Krieg, den er als Flakhelfer mitmachte, hervorgegangen war. Das Bild, was von den Gründerjahren der DDR in den frühen 50er Jahren entfaltet wird, ist bestimmt von krassen Farben, bunten Charakteren und unbeschönigt ausgestellten Härten der gesellschaftlichen Konflikte und individuellen Verstrickungen. Über einen Neulehrerkurs kommt Jablonski in das Schulwesen, als Direktor und Schulrat, bis er in der Folge des 17. Juni wegen "Passivität" entlassen und zur Bewährung in die Produktion geschickt wird, wo er zu schreiben beginnt. Zum Beispiel über eine vorbildliche Brigade, was auch erfolgreich verfilmt wird. Immer wieder zettelt Jablonski Intrigen an oder er verstrickt sich in die anderer. Seine mangelnde menschliche Aufrichtigkeit und Beziehungsstörungen zu Frauen und Freunden analysiert er detailliert. Insgesamt kein sehr sympathischer Zeitgenosse, alles andere als ein strahlender Held. Eine Reihe starker Persönlichkeiten bestimmen jedoch seinen Weg: der proletkulthafte Widerstandskämpfer und Parteifunktionär Imme, der verständnisvoll gezeichnete sowjetische Kulturoffizier, dessen unerlaubte Liebesbeziehung zu einer deutschen Frau tragisch endet. Dem russischen Kommandanten hatte der Krieg "seine Seele getötet" und er kann kein Vertrauen zu den Deutschen aufbringen. Im Frühsommer 1953 scheint Jablonski "die Emotion die Vernunft zu erdrücken". Er führt einen erbitterten und überspitzten Kampf gegen den Religionsunterricht, während die Chemiearbeiter gegen die erhöhten Normen und die schlechte Versorgungslage zu rebellieren beginnen.. Den "Aufstand" des 17. Juni erlebt Jablonski als einer, der "die Tragweite des Geschehens" nicht überblickt. Er fühlte sich "hilflos", hielt nicht für möglich, was doch möglich war. Während andere von Konterrevolution sprechen, verhält er sich abwartend. Erst Imme, der ihm als einziger an diesem Tag "aufrichtig und entschlossen begegnet", folgt er zu den Demonstrierenden auf dem verregnetem Marktplatz. Dieser, dessen Devise stets "Die Macht geben wir nicht mehr aus den Händen" gelautet hatte, versucht, gegen ein Lautsprechergedröhn anzuschreien. "Bürger, ihr seid doch Arbeiter. Begreift ihr nicht, nichts begreift ihr, begreift doch". Die zehntausend hatten "ratlose Gesichter, böse Gesichter, gleichgültige Gesichter, lachende Gesichter." Von einem Stein wird Imme tödlich getroffen, was die Leute auseinander treibt. Für Jablonski ist Imme ein Held. "Um diese kurze Spanne seines Lebens beneide ich ihn. Ohne die Erinnerung an Imme hätte ich nicht ertragen, was ich in meinem Land ertragen mußte. Die Depression nicht und nicht den Ruhm."
|

|

|
Heiner Müller: Germania Tod in Berlin, Berlin (West) 1977/Berlin (DDR) 1988
In diesem deutsche Geschichte thematisierenden Stück, dessen erste Szenenentwürfe bis in das Jahr 1956 zurückgehen, zeigt Müller in 13 Bildern Signaturen deutscher Geschichtsverläufe mit Preußentum und Militarismus, Novemberrevolution, Nationalsozialismus und deutscher Zweistaatlichkeit nach 1945. Als deren Akteure erscheinen neben Friedrich II und dem Müller von Sanssouci, Rosa Luxemburg, Hitler und Goebbels, das Volk in Gestalt der feindlichen "Brüder", des "ewigen Maurers", des "Kommunisten" u.a. In drei Szenen dieses Stückes, das ohne Fabel durch parallel gesetzte Szenen mit mythischen und surrealen Akzenten strukturiert ist, wird auf das Geschehen des 17. Juni bezug genommen. Gemeinsam ist diesen der Handlungsbezug zum Maurermilieu der Berliner Stalinallee. In "Das Arbeiterdenkmal" wird die konfliktreiche Situation unter den Bauarbeitern in deren erregter Diskussion zum Problem der Normerhöhungen gezeigt. Die bunt zusammen gewürfelte Mannschaft (ein ehemaliger General, ein degradierter Minister, ein junger und ein dicker Maurer) folgt den Streikaufrufen, denn "Akkord ist Mord". Die Ausnahme bildet der alte Maurer Hilse, der von den anderen als "Russenknecht" und "Arbeiterverräter" beschimpft, sich nicht "verrückt" machen läßt und weiterarbeitet. Von halbstarken Jugendlichen (kahlköpfig, mit Fahrrädern) gedemütigt und blutig zusammengeschlagen, sieht sein unter dem Steinehagel zusammengebrochener Körper den Jugendlichen Rockern wie ein "Arbeiterdenkmal" aus.
Hilse überlebt diesen Anschlag, stirbt aber dann an Krebs. "Wir sind eine Partei, mein Krebs und ich." Hilse sieht sich als den "ewigen Maurer" und ihm erscheint in der Freundin des jungen Maurers, einer Prostituierten, die ihn zusammen besuchen, die "rote Rosa": "Und immer war es für die Kapitalisten zehntausend Jahre lang. Aber in Moskau war ich zum ersten Mal mein eigner Chef : Die Metro. Hast du sie gesehn. Und jetzt hab ich die Kapitalisten eingemauert Ein Stein ein Kalk. Wenn du noch Augen hättest Könntest du durch meine Hände scheinen sehn Die roten Fahnen über Rhein und Ruhr."
In der Szene "Die Brüder 2" befinden sich gemeinsam in einer Gefängniszelle als feindliche Brüder "der Kommunist" und "der Nazi", "der Brückensprenger" und "Gandi", ein Mörder. Von draußen dringt "Volkslärm" und "Wortsalat aus FREIHEIT DEUTSCH TOTSCHLAGEN AUFHÄNGEN" in die Zelle. Während der Kommunist nicht an eine Arbeitererhebung glauben kann ("Warum schießen sie nicht. Das kann nicht wahr sein. Genossen, haltet das Gefängnis. Schießt."), erwarten die anderen von dem "Volksaufstand" ihre Befreiung. Sie bereiten sich auf eine blutige Abrechnung mit seinesgleichen vor: "Dann wird geflaggt mit den Genossen. Die Fahne hoch. Heute wird Platz an jeder Fahnenstange." Die Brüder stehen sich unversöhnlich gegenüber: der Nazi berichtet, wie er durch falsches Mißtrauen der Kommunisten zum Spitzel wurde. "Der kurze Lehrgang im Gestapokeller. (...) Wer wußte, daß ich nicht gesungen hab, Und als ich wieder in den Keller ging In meinem Rücken nur noch meinen Rücken Ging ich allein, für euch war ich der Spitzel."
Der Kommunist, von den anderen als "Lump, Vaterlandsverräter, Russenknecht" beschimpft, erinnert sich, daß er solches schon mal gehört habe. Als er auf einem Lagertransport, bewacht von der SA, "Mit Handschelln durch die schöne deutsche Heimat. Es war im Frühjahr" vom gaffenden "Volk" bespuckt "vor deutschem Speichel Die schöne deutsche Heimat nicht mehr" habe sehen können. Während der Nazi resümiert: "Das ist der Lauf der Welt. Mach dir nichts draus, sie ist ein Schlachthaus, Bruder" sind Geräusche von Panzern zu hören. Freudig begrüßt vom Kommunisten, für den damit "der Spuk" vorbei ist. "So gern wie heute hab ich sie (die Internationale) nie gehört gesungen von Panzerketten, Spitzel." Der Kommunist wird von den dreien umgebracht. Seine letzte Frage lautet: "Wer bin ich".
Müllers Blick auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft zeigt die Zerrissenheit der Menschen, die bewußten Arbeiter und "Kommunisten" erscheinen als tragische Minderheit. Die Konnotation reaktionärer und konterrevolutionärer Aspekte ist deutlich. Die Apotheose Hilses mit den Roten Fahnen über Rhein und Ruhr zeigt visionäre Züge.
Das von Müller 1971 abgeschlossene Stück erlebte seine Uraufführung in München 1978. Interessant sei die unterschiedliche Reaktion in Ost und West gewesen, erinnerte sich der Autor 1992 (Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln). "Die Ablehnung war gesamtdeutsch, die Argumentation verschieden. Georg Hensel, Kritiker der FAZ, schrieb über die Unverschämtheit, Steuergelder zu verschwenden auf die Aufführung eines Machwerks, das alle SED-Propagandalügen über den Volksaufstand des 17. Juni kolportiert. Das haben Theaterleute der DDR versucht als Argument zu verwenden für die Aufführbarkeit in der DDR. Es wurde sogar eine Kommission von Historikern gebildet, die über die Frage der Aufführbarkeit des Stücks entscheiden sollte. Die Antwort blieb Nein." Erst 1988 wurde der Text in der DDR gedruckt und auch am Berliner Ensemble inszeniert.
Thomas Brasch: Rotter, Frankfurt a. M 1978
Als Thomas Brasch nach diversen Konflikten in der DDR, u. a. wurde er 1968 wegen "staatsfeindlicher Hetze" verhaftet, Ende 1976 nach West-Berlin ausreisen konnte, hatte er sein Stück "Rotter", das 1977 am Stuttgarter Schauspiel aufgeführt wurde, schon begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Ihn interessierte "Biographie als Arbeitsfeld für Geschichte" und so stellt er seine Figur Rotter in die brutalen Geschichtsverläufe des 20. Jahrhunderts. Gezeigt wird mit Rotter ein (vielleicht) typisch deutscher Mitläufer-Typ, der auch als sog. Durchschnittsdeutscher begriffen werden kann. Jung als begeisterter Nazi sozialisiert und als "Gruppenführer" Soldaten "hart wie Kruppstahl" ausbildend, stellt er sich nach Kriegsende verblüffend bruchlos der "neuen Ordnung" zum Enttrümmern und Wiederaufbau zur Verfügung. Er nimmt mit seiner angebrochenen Lehre als Fleischer einen gesellschaftlichen "Aufstieg" vom Brigadier zum Baustellenchef einer Talsperre und Einsatzleiter eines großen Erdöl-Kombinatsbau. Er ist ein deutsches Arbeitstier, sein Privatleben wird zerstört durch das Nomadenleben. Lackner, sein bester Freund und Widersacher, ist eine andere Lebensvariante: anarchistisch, asozial und kriminell, ist er für die "Abschaffung der Arbeit" an sich.
In der Szene "Streik" erfahren Arbeiter und Monteure aus dem DDR-Radio, und nicht aus dem RIAS, von den Berliner Ereignissen: "In Berlin haben unverantwortliche Gruppen von Bauarbeitern die Arbeit niedergelegt und sich zu Demonstrationen gegen die Regierung versammelt. Ihr Aufruf ist in provokatorischer Absicht übernommen worden. Die Arbeitsniederlegungen stellen einen Versuch dar, den friedlichen Aufbau zu stören und die alte Ordnung wiederherzustellen (...). Die Gewerkschaften und die Regierung warnen jeden vor dem Versuch, sich der ungesetzlichen Aktion anzuschließen." Nach kurzer Diskussion entschließen sich fast alle zum Streik. "Der Krug geht solange zum Wasser bis er bricht. Aus abgeschabten Knochen wächst kein neuer Staat. Die Losung heißt: Wie wir heute essen, werden wir morgen arbeiten, nicht umgekehrt." Man schließt sich mehrheitlich der Forderung nach "Arbeiterräten und Amnestie" an. Als Lackner nichts vom Streik hält: "Absetzung der Regierung. Was ändert sich. Weniger als nichts. Der neue Hut auf eine alte Glatze. Amnestie. Mir mußt du davon nichts erzählen. Aus einem kleinen Knast in einen großen. Freiheit im Leistungslohn, bis daß der Tod euch scheide", mauern ihn die Monteure und Arbeiter in einen Schornstein ein. Der hinzukommende Rotter findet seine Kollegen "verrückt" geworden. "Schluß mit dem Volksfest. Holt Lackner aus dem Schornstein, geht an eure Arbeit oder in zehn Minuten ist die Polizei da (...) Begreift ihr nicht: der Bau gehört uns allen." Als Rotter mit der Bemerkung "Vielleicht lernt ihr die Arbeit wieder vor Gewehren" sich entfernen will, wird er als "Sprücheklopfer" in eben jenen Schornstein eingemauert, aus dem sich Lackner im Getümmel gerade selbst befreien konnte. Der sarkastische Kommentar der Streikwilligen: "Dein Aussichtsturm ist fertig. Hier hast du guten Überblick über die historischen Ereignisse." Am nächsten Morgen, als der Streik vorbei ist, wird Rotter aus dem Schornstein befreit. Als die Polizisten "seine Leute" als "Gesetzesbrecher" verhaften wollen, wendet sich Rotter vergeblich dagegen. Die Termine seien auch ohne Streik schon vier Tage überschritten. "Wem nützen die, wenn sie im Kittchen Tüten kleben." Der Streik erscheint bei Brasch als von den Arbeitern ausgedacht und durchgeführt. Die Forderungen der Arbeiter und Monteure richten sich auf mehr soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Demokratie. Rotter hat sich in den Augen der Herrschenden bewährt und sein Aufstieg setzt sich fort. Am Ende wird er "Held der Arbeit", muß jedoch zugleich seinen Posten an Qualifiziertere abgeben, worauf er durchdreht. "Jede Zeit braucht ihre Helden, und Rotter war ein Held in unserer". Ihm wird vorgeschlagen, ein Buch über sein Leben zu schreiben. "Das Finanzielle soll nicht deine Sorge sein. Unsere Unterstützung hast du. Die Jungen sollen wissen, wie schwer es war in deinen 55 Jahren."
|

|

|
|
|